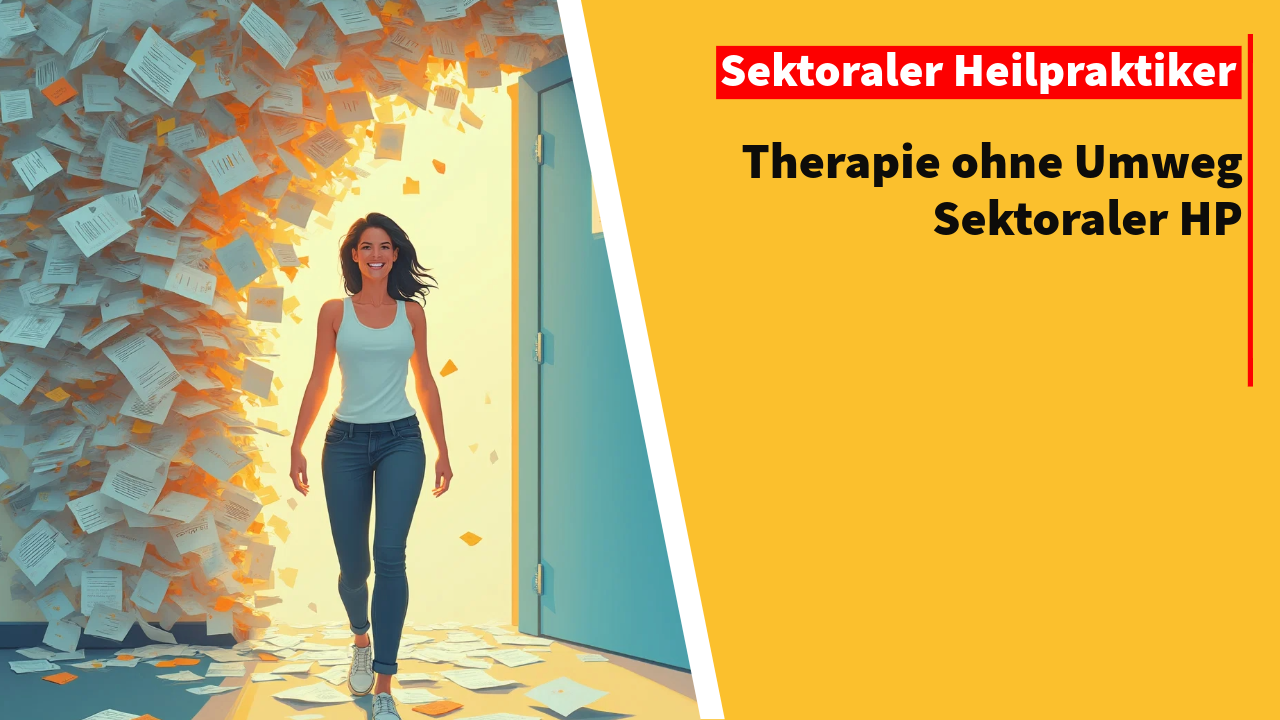Wer Rückenschmerzen hat, braucht Hilfe – keinen Umweg
In den Niederlanden geht’s direkt zur Physiotherapie. In der Schweiz auch.
Nur in Deutschland zwingt das System Patient:innen mit Rückenschmerzen zuerst zum Arzt – obwohl es eine Möglichkeit gäbe die physiotherapeutische Kompetenz direkt wirksam werden zu lassen.
Von den höchsten deutschen Gerichten gibt es längst eine geschaffene Lösung: den sektoralen Heilpraktiker.
mit Fachkompetenz, Red-Flag-Screening und unmittelbarer Aktivierung.
Was fehlt? Die Anerkennung durch die GKV – für eine Versorgung, die wirkt.
Und genau hier beginnt das Problem:
Als Patient:in hast du Schmerzen, willst Hilfe – und bekommst stattdessen erstmal ein Wartezimmer. Die Versorgung folgt nicht dem, was medizinisch sinnvoll wäre, sondern dem, was historisch gewachsen und bürokratisch geregelt ist.
Ergebnis: Zeitverzug, unnötige Chronifizierung und ein System, das sich selbst im Weg steht.
Als Physiotherapeut:in weißt du, was zu tun ist. Du erkennst Muster, funktionelle Ursachen, bewegungsbedingte Schmerzmechanismen. Du kannst helfen, beherrschst die red flags, die Patientenedukation und die frühzeitig aktivierende Therapie. Aber du darfst nicht.
Du wirst systematisch in die zweite Reihe gestellt, obwohl du längst bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
Und wenn du es doch tust – z. B. im Rahmen des sektoralen Heilpraktikers – dann wird deine Leistung zur Privatangelegenheit. Nicht, weil sie schlechter wäre, sondern weil das aktuelle Gesundheitssystem sie nicht vorgesehen hat.
Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Frühzeitige Aktivierung, funktionelle Therapie und gezielte Edukation sind die wirksamsten Maßnahmen bei unspezifischem Rückenschmerz. Physiotherapeut:innen sind dafür fachlich hervorragend qualifiziert – sie erkennen Muster, schätzen Risiken ein und begleiten aktiv. Doch sie dürfen es nicht eigenständig tun, solange sie sich nicht den Weg über den sektoralen Heilpraktiker erarbeitet haben. Statt diese funktionierende Lösung in die Regelversorgung zu integrieren, verliert sich das System seit Jahren in akademischen Debatten über Zuständigkeiten, neue Berufsrollen und Modellprojekte. Während diskutiert wird, warten die Patient:innen.
Warum sollte ich bei Rückenschmerzen nicht zuerst zum Hausarzt gehen?
Was bedeutet das konkret für Patient:innen im Alltag?
Wenn Du mit Rückenschmerzen in eine hausärztliche Praxis gehst, bekommst Du in den meisten Fällen kein umfassendes Therapiekonzept – sondern eine Zwischenstation. Die Zeit ist knapp, die Diagnostik oft rein symptomorientiert und die nächste Maßnahme ist nicht selten ein Rezept für Schmerzmittel oder eine Überweisung zum Radiologen. Bildgebung, obwohl laut S3-Leitlinie bei unspezifischen Kreuzschmerzen nur bei konkretem Verdacht auf schwerwiegende Ursachen angezeigt, wird überproportional häufig eingesetzt. Ebenso Medikamente: schnell, einfach, aber selten nachhaltig.
Was dabei meist fehlt, ist ein gezielter funktioneller Befund, der Deine Beschwerden im Alltag, in der Bewegung, in Deinem Verhalten einordnet. Der einzige therapeutische Zugang – Physiotherapie – wird häufig verzögert verordnet. Erst wenn Medikamente nicht wirken oder sich der Zustand verschlechtert, wird das Rezept ausgestellt. Bis dahin hast Du vielleicht schon Wochen verloren. Wochen, in denen eine aktive Therapie längst hätte greifen können.
Die Leitlinie empfiehlt in dieser Phase durchaus Bewegung und Edukation – ordnet beides aber primär dem hausärztlichen Setting zu. Nicht, weil Ärzt:innen dafür die besten Voraussetzungen hätten, sondern weil das System keine andere Zuständigkeit vorsieht. Die bestehenden Kompetenzen der Physiotherapeut:innen werden dabei schlicht ignoriert. Statt klar zu benennen, dass es längst eine Berufsgruppe mit genau diesem Know-how gibt, bleibt die Leitlinie systemkonform: Sie strukturiert entlang der bestehenden Zuständigkeiten – nicht entlang der tatsächlichen Versorgungsqualität.
Das ist kein Vorwurf an die Hausärzt:innen, sondern ein strukturelles Problem: Sie sind Generalisten im Minutentakt – nicht spezialisierte Bewegungstherapeuten. Trotzdem verlangt das System, dass sie zuerst entscheiden, was mit Deinem Rücken geschieht. Als Physiotherapeut:in wird Dein Wissen und Deine Kompetenz in funktioneller Diagnostik erst dann abgerufen, wenn jemand anderes es für nötig hält – nicht, wenn Du es fachlich längst für geboten hältst.
Weil Physiotherapeut:innen die funktionellen Ursachen besser erfassen.
Rückenschmerz ist selten ein statisches Problem. Er ist komplex, individuell, verhaltensabhängig – und genau das ist der diagnostische und therapeutische Fokus der Physiotherapie. Bewegung, Haltung, Alltagsverhalten, Schmerzverarbeitung: Physiotherapeut:innen analysieren das systematisch. Sie erkennen funktionelle Zusammenhänge, erfassen Belastungsreaktionen und entwickeln daraus konkrete Interventionen.
Dazu kommt: Auch die Patientenedukation – ein zentraler Bestandteil der aktuellen Leitlinie – liegt bei Physiotherapeut:innen in besseren Händen. Nicht, weil Ärzt:innen nicht beraten können, sondern weil das ärztliche Setting es kaum zulässt. Fünf Minuten reichen nicht für ein verständliches Gespräch über Chronifizierung, Bewegungssicherheit oder Selbstwirksamkeit.
Physiotherapeut:innen dagegen sind darauf spezialisiert, genau das zu tun: Ängste nehmen, Wissen vermitteln, individuell aktivieren. Nicht mit pauschalen Broschüren, sondern mit alltagsnaher, bewegungsorientierter Begleitung.
Sie können das – und sie tun das. Aber nur dann, wenn sie dürfen. Und das ist im deutschen System erst nach ärztlicher Freigabe der Fall. Oder eben: wenn sie als sektorale Heilpraktiker:innen handeln.
Was sagt die medizinische Leitlinie zu Physiotherapie bei Rückenschmerzen?
Sie empfiehlt Edukation
Die S3-Leitlinie Kreuzschmerz spricht sich eindeutig für edukative Maßnahmen aus: Patient:innen sollen frühzeitig über die Ursachen, den typischen Verlauf und die positiven Effekte von Bewegung bei Rückenschmerzen aufgeklärt werden. Ziel ist, Angst zu nehmen, Selbstwirksamkeit zu fördern und Chronifizierung zu verhindern.
Doch obwohl Physiotherapeut:innen für genau diese Art der Beratung ausgebildet sind, werden sie in der Leitlinie nicht als primäre Umsetzer benannt. Die Verantwortung liegt explizit bei den Hausärzt:innen. Dort soll das Aufklärungsgespräch stattfinden – trotz Zeitdruck, trotz fehlender Spezialisierung auf funktionelle Zusammenhänge. Die Leitlinie beschreibt damit weniger eine optimale Versorgung als vielmehr das, was im deutschen System eben vorgesehen ist: ärztliche Steuerung, therapeutische Umsetzung nachrangig.
Physiotherapie wird empfohlen – aber nur nach ärztlicher Sichtung
Die Rolle der Physiotherapie bleibt damit nachgeordnet. Sie wird empfohlen, ja – aber erst nach ärztlicher Diagnostik und Red-Flag-Ausschluss. Das heißt: Selbst wenn Patient:innen eigentlich sofort von aktiver Bewegung profitieren würden, müssen sie warten. Auf einen Arzttermin, auf eine Einschätzung, auf ein Rezept.
In der Praxis bedeutet das: Erst werden Medikamente verschrieben, vielleicht eine Bildgebung angeordnet, eventuell ein paar Wochen abgewartet. Erst danach erfolgt der Zugang zur Physiotherapie – wenn überhaupt. Diese Verzögerung widerspricht der Intention der Leitlinie, die frühe Aktivierung und Patientenedukation ausdrücklich betont. Doch die systemische Struktur zwingt den Prozess in eine Reihenfolge, die aus therapeutischer Sicht wenig Sinn ergibt.
Der sektorale Heilpraktiker ist der einzige Weg, Leitlinie und Versorgung zu versöhnen
Hier kommt der sektorale Heilpraktiker ins Spiel – als Brücke zwischen fachlicher Evidenz und rechtlicher Realität. Denn nur mit dieser Zusatzqualifikation dürfen Physiotherapeut:innen im deutschen System selbst untersuchen, Red Flags ausschließen, Diagnosen treffen und direkt behandeln. Das ist rechtlich erlaubt, fachlich sinnvoll und inhaltlich vollständig leitliniengerecht – also evidenzbasiert.
Was aktuell fehlt, ist nicht die fachliche oder juristische Grundlage, sondern die systemische Anerkennung. Während sich Politik, Kassen und Verbände in der Diskussion um Modellversuche, Direktzugang und neue Berufsbilder verlieren, wartet der Mensch mit Schmerzen. Die Debatte kostet Zeit. Der sektorale Heilpraktiker könnte längst helfen – wenn man ihn ließe.
Der sektorale Heilpraktiker ist rechtssicher der optimierte Erstkontakt bei Rückenschmerzen!
Das System diskutiert – der sektorale HP handelt bereits
Während politische Gremien, Kassen und Fachgesellschaften über neue Modelle sprechen, schafft der sektorale Heilpraktiker längst Fakten. In vielen Praxen wird er bereits als effektiver Erstkontakt genutzt – insbesondere bei Rückenschmerzen, wo eine schnelle funktionelle Einschätzung und gezielte Aktivierung den größten Effekt haben. Modellversuche und neue Versorgungsansätze mögen kommen – doch parallel zeigt der sektorale Heilpraktiker schon heute, wie direkte Hilfe verantwortungsvoll und wirksam möglich ist.
Es braucht Therapeut:innen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wer als sektoraler Heilpraktiker arbeitet, setzt seine erworbenen Fähigkeiten und therapeutischen Kompetenzen auf einer klaren juristischen Grundlage um.
Der sektorale HP schafft rechtliche Klarheit
Mit der sektoralen Heilpraktikererlaubnis erhalten Physiotherapeut:innen das Recht, eigenständig zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu behandeln – ganz ohne ärztliche Verordnung. Das bedeutet: Red-Flag-Screening, edukative Beratung und aktivierende Therapie können direkt stattfinden, ohne systembedingte Verzögerung. Damit wird nicht nur die Versorgung effizienter – es entsteht auch echte Therapiefreiheit im Sinne der Patient:innen. In einem System, das sich durch Bürokratie oft selbst blockiert, bietet der sektorale HP einen rechtssicheren und zugleich fachlich fundierten Weg zur direkten Hilfe.
Trotzdem bleibt es ein Nischenmodell
Trotz seiner fachlichen und rechtlichen Schlagkraft ist der sektorale Heilpraktiker bislang ein Nischenmodell – aus einem simplen Grund: Die GKV erkennt seine Leistungen nicht an. Patient:innen müssen die Behandlung privat zahlen, obwohl sie nachweislich leitliniengerecht und wirksam ist. Das schafft eine soziale Schieflage: Wer es sich leisten kann, bekommt bessere Versorgung. Wer auf das Kassensystem angewiesen ist, muss warten – oder mit suboptimalen Maßnahmen vorliebnehmen. Die Folge: Eine strukturierte, rechtlich abgesicherte und fachlich exzellente Versorgung wird künstlich klein gehalten, obwohl sie das Potenzial hätte, ein zentraler Pfeiler der Rückenschmerztherapie zu sein.
Wie funktioniert das Modell in anderen Ländern – und was können wir lernen?
In der Schweiz und den Niederlanden geht’s längst direkt zur Physio.
In beiden Ländern ist der Direktzugang zur Physiotherapie gesetzlich geregelt – und längst Teil der Regelversorgung. Wer dort mit Rückenschmerzen zur Behandlung geht, kann unmittelbar eine:n Physiotherapeut:in aufsuchen. Ohne Überweisung, ohne Wartezeit beim Hausarzt, ohne Umweg über Rezepte oder Bürokratie. Und das hat Folgen: Die Versorgung ist schneller, zielgerichteter und kosteneffizienter. Studien zeigen, dass der Direktzugang nicht nur zu vergleichbaren, sondern oft sogar zu besseren gesundheitlichen Ergebnissen führt – mit weniger Chronifizierungen und geringerer Inanspruchnahme unnötiger bildgebender Verfahren.
Physiotherapeut:innen übernehmen dort eine echte Gatekeeper-Funktion: Sie screenen Red Flags, schätzen funktionelle Beschwerden ein und entscheiden über Weiterverweisung – immer mit dem Ziel, den oder die Patient:in so früh wie möglich in eine aktive Behandlung zu bringen. Das Vertrauen in ihre fachliche Kompetenz ist systemisch verankert – und die Versorgung profitiert davon.
Eine Übersichtsarbeit mit fünf systematischen Reviews und 17 Primärstudien zeigt: Aus Sicht der Patient:innen gibt es beim direkten Zugang zur Physiotherapie keine Nachteile beim Schmerzverlauf – aber Tendenzen zu besserer Lebensqualität, Funktion und allgemeinem Wohlbefinden. Auf Seiten der Behandler:innen zeigen sich eine höhere Behandlungstreue und präzisere Entscheidungen. Und aus gesellschaftlicher Perspektive ergeben sich klare Vorteile: weniger Wartezeit, weniger Medikamente, weniger Bildgebung – und tendenziell niedrigere Gesundheitskosten[^Cattrysse et al., 2024].
In Deutschland verhindert der rechtliche Rahmen, was fachlich längst möglich wäre.
Und in Deutschland? Hier liegt die Lösung längst vor – aber nicht im Gesetz, sondern im Gerichtssaal. Während andere Länder den Direktzugang politisch gestaltet haben, entstand in Deutschland ein vergleichbarer Weg durch rechtliche Klarstellung: der sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie. Der Direktzugang zur Physiotherapie bleibt eine Ausnahme in Modellversuchen – nicht die Regel. Die notwendige Erstdiagnose durch eine:n Ärzt:in bremst viele Prozesse aus, obwohl die Leitlinie längst eine frühzeitige Aktivierung fordert. Statt funktionierende Lösungen zu implementieren, verliert sich das deutsche System in Modellprojekten, Zuständigkeitsfragen und endlosen Diskussionen über Akademisierung und Berufsgrenzen. Währenddessen bleibt der sektorale Heilpraktiker ein rechtlich sauberer, aber institutionell ignorierter Weg: Er ermöglicht direkte Hilfe – wird jedoch kaum als offizielle Lösung anerkannt.
Dabei ist dieser Weg längst geklärt – sowohl fachlich als auch rechtlich. Die Leitlinien belegen die Wirksamkeit früher physiotherapeutischer Intervention. Und die höchsten deutschen Gerichte haben mit der sektoralen Heilpraktikererlaubnis eine rechtssichere Möglichkeit geschaffen, genau das umzusetzen. Es braucht keine weiteren Studien und keine neuen Gesetze. Was fehlt, ist nicht Klarheit – sondern der politische Wille, das Offensichtliche auch systemisch anzuerkennen. Evidenz und Rechtslage sind da. Die Umsetzung bleibt aus.
Der sektorale HP ist nicht durch Reformwille entstanden, sondern durch höchstrichterliche Entscheidungen – als sachgerechte Antwort auf ein unzeitgemäßes System. Während andere Länder den Direktzugang aktiv gestalten, duckt sich die deutsche Gesundheitspolitik weg. Die Gerichte haben geliefert. Die Politik hat nicht umgesetzt.
Fakt bleibt: Die Versorgung funktioniert dort, wo jemand Verantwortung übernimmt. Und das ist derzeit in Deutschland möglich durch den sektoralen Heilpraktiker. Er steht für eine Praxis, die sich nicht an der Bürokratie, sondern an der Wirksamkeit orientiert.
Wenn wir also von anderen Ländern lernen wollen, dann nicht nur durch das Kopieren von Gesetzen - sondern durch die Anerkennung einer Haltung: Wer helfen kann, sollte dürfen. Und wer Verantwortung übernehmen will, sollte auch systemisch unterstützt werden.
Warum übernimmt die GKV die Kosten für sektorale HP-Behandlungen nicht?
Weil das Modell außerhalb der Logik des GKV-Systems steht.
Der sektorale Heilpraktiker ist rechtlich eindeutig geregelt: Die Berufserlaubnis ist durch höchstrichterliche Entscheidungen abgesichert, die fachliche Eignung des sektoralen HP ist durch ein Staatsexamen geprüft – es gibt also klare Standards. Auch die Behandlungen orientieren sich an den S3-Leitlinien, sind evidenzbasiert und therapeutisch sinnvoll. Doch obwohl all das erfüllt ist, bleiben die Leistungen aus Sicht der GKV „außerhalb des Systems“. Der Grund ist nicht die fehlende Wirksamkeit – sondern schlicht die fehlende Integration in die Logik des GKV-Katalogs. Die Leistungen des sektorelen HP passen nicht in das gewohnte Rollenverständnis des Systems. Nicht ärztlich, nicht verordnungsgebunden, nicht vorgesehen. Was hilft, wird übersehen, wenn es außerhalb etablierter Zuständigkeiten geschieht.
Das ist keine Schwäche des Konzepts – sondern ein systembedingtes Versäumnis..
Was hier entsteht, ist mehr als eine Lücke – es ist eine strukturelle Verweigerungshaltung. Die GKV ignoriert einen rechtlich erlaubten und fachlich sinnvollen Weg, weil er nicht von Ärzt:innen verordnet wird. Die systemische Logik folgt nicht der medizinischen Evidenz, sondern dem Prinzip der Standesgrenzen. Wer hilft, zählt nicht – wer verordnet, zählt.
Dabei könnten sektorale Heilpraktiker:innen ein integraler Teil der Rückenschmerzversorgung sein. Sie arbeiten evidenzbasiert, übernehmen Verantwortung und tun genau das, was die Leitlinie fordert: edukative Gespräche, funktionelle Aktivierung, Verzicht auf unnötige Diagnostik. Aber weil sie außerhalb des ärztlichen Systems stehen, bleibt ihre Arbeit privat zu finanzieren. Nicht, weil sie schlechter wäre – sondern weil sie nicht vorgesehen ist.
Diese Art der Ausgrenzung ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines Systems, das historisch gewachsene Rollenmuster höher bewertet als die Versorgung der Patient:innen. Wer helfen kann, darf nur dann helfen, wenn er formal dazugehört. Das Resultat: gut dokumentierte Wirksamkeit – aber keine Kassenleistung. Eine paradoxe Situation, die weder medizinisch noch ethisch zu rechtfertigen ist.
Was wäre nötig, um das Modell des sektoralen HP in die Regelversorgung zu bringen?
Umsetzung im GKV-System: strukturelle Integration statt Blockade
Der sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie arbeitet evidenzbasiert, leitlinienkonform und rechtlich abgesichert. Seine Qualifikation basiert auf dem Staatsexamen, ergänzt durch die sektorale Erlaubnis nach höchstrichterlicher Rechtsprechung – ein klar geregelter und geprüfter Weg. Was fehlt, ist die strukturelle Integration in die Logik des Sozialgesetzbuchs (SGB V). Denn dort ist eine Kostenübernahme weiterhin an eine ärztliche Verordnung gebunden. Leistungen von Heilpraktiker:innen – auch sektoralen – sind nicht Teil des GKV-Leistungskatalogs. Nicht, weil sie nicht wirksam wären, sondern weil sie im aktuellen System schlicht nicht vorgesehen sind.
Eine gesetzliche Anpassung wäre möglich – etwa durch eine gezielte Öffnung des § 92 SGB V, der die Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses regelt. Dieser Paragraf bestimmt, welche Leistungen in die GKV-Regelversorgung aufgenommen werden dürfen und wer sie erbringen kann. Eine ergänzende Regelung könnte sektorale Heilpraktiker:innen mit physiotherapeutischer Ausbildung als eigenständigen Zugangsweg definieren – basierend auf ihrer bestehenden Qualifikation und rechtlichen Zulassung.
Solange das ausbleibt, bleibt die Versorgung durch sektorale HP formal „außerhalb des Systems“. Das benachteiligt nicht nur Patient:innen mit geringem Einkommen, sondern entzieht der GKV eine wirksame, ressourcenschonende Versorgungsoption. Eine klare Ausnahme-Regelung zur Kostenübernahme – gezielt für sektorale Heilpraktiker:innen und basierend auf ihrer definierten Qualifikation – wäre sofort möglich, gesetzlich abbildbar und praktisch umsetzbar. Es braucht keine neuen Modellprojekte. Alles ist vorhanden. Was fehlt, ist der politische Wille, funktionierende Lösungen nicht länger zu blockieren.
Umsetzung in der Ausbildung: Integration statt Nachqualifikation
Gleichzeitig braucht es eine sinnvolle Verankerung in der Ausbildung – damit aus struktureller Ausnahme endlich systemischer Standard wird. Statt neue Berufswege zu erfinden, sollten bestehende sinnvoll ergänzt werden. Die Inhalte zur Vorbereitung auf die sektorale Heilpraktikererlaubnis – insbesondere medizinisches Grundwissen, rechtliche Rahmenbedingungen und Red-Flag-Kompetenz – könnten systematisch in die Ausbildungscurricula von Berufsfachschulen und Studiengängen für Physiotherapie integriert werden.
So würde die Qualifikation nicht nachträglich „erworben“, sondern direkt im Rahmen der Berufsausbildung mitgedacht. Die Gesundheitsämter müssten im Gegenzug bundeseinheitlich anerkennen: Wer die geforderten Kenntnisse nachweist, erfüllt die Voraussetzungen für die schriftliche Anerkennung der sektoralen Heilpraktikererlaubnis. Kein Sonderweg, keine zusätzliche mündliche Prüfung – sondern ein klarer, pragmatischer Schritt in Richtung struktureller Entlastung und Versorgungsqualität. Gerade im überlasteten Gesundheitssystem wäre das sofort wirksam – ohne Qualitätsverlust, aber mit echtem Mehrwert.
Politischer Wille: Wirksamkeit vor Zuständigkeit
Die Lösung liegt auf dem Tisch. Doch statt vorhandene Wege zu stärken, verliert sich das System in langwierigen Diskussionen über neue Rollen, Reformpläne und Modellprojekte, die kaum je in der Fläche ankommen. Dabei wäre der nächste Schritt einfach: Anerkennen, was funktioniert. Der sektorale HP ist keine Idee – er ist Realität. Medizinisch fundiert, juristisch eindeutig, in der Praxis bewährt.
Denn letztlich scheitert es nicht an der Machbarkeit – sondern am fehlenden politischen Willen. Solange sich das System an Zuständigkeiten festhält und nicht an Wirksamkeit orientiert, bleibt Fortschritt blockiert. Aber genau hier könnte der Wendepunkt liegen: Ein Gesundheitssystem, das bereit ist, funktionierende Strukturen zu integrieren – zum Nutzen der Patient:innen, der Therapeut:innen und der Versorgung insgesamt.
Fazit: Schluss mit Umwegen – patientengerechte Versorgung braucht Kompetenz
Aus Sicht der Patient:innen ist der Bedarf eindeutig:
Sie brauchen frühzeitige Hilfe – nicht Wartezeiten, Überweisungen oder Umwege. Wer Schmerzen hat, will wirksame Therapie. Und genau die gibt es!
Wenn du sektoraler HP bist: Positioniere dich als Erstkontakt.
Du arbeitest rechtssicher, leitliniengerecht und mit einem klaren Versorgungsauftrag. Mach deine Rolle sichtbar – in deiner Praxis, in der Kollegenschaft, in der öffentlichen Diskussion. Du bist kein Sonderfall. Du bist ein Teil der Lösung.
Wenn du es noch nicht bist: Überlege, ob das dein nächster logischer Schritt ist.
Nicht als Notlösung, sondern als konsequente Erweiterung deiner Handlungskompetenz. Der sektorale HP gibt dir die rechtliche Freiheit, deine therapeutischen Fähigkeiten dort einzusetzen, wo sie am meisten bewirken: direkt, frühzeitig und selbstbestimmt.
Denn Veränderung beginnt nicht mit Gesetzen – sondern mit Haltung.
Literatur
[^Cattrysse et al., 2024] Cattrysse, E., Broeck, J. V. D., Petroons, R., Teugels, A., Scafoglieri, A., & Trijffel, E. van. (2024). Impact of direct access on the quality of primary care musculoskeletal physiotherapy: a scoping review from a patient, provider, and societal perspective. Archives of Physiotherapy, 20–28. https://doi.org/10.33393/aop.2024.3023